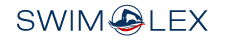Serum (serum), flüssiger Bestandteil des Blutes (→Blutserum) ohne die zellulären Elemente (Blutplasma minus Fibrinogen), auch Bezeichnung für Impfstoff. Veränderungen im Blutserum werden in der Sportmedizin als Indikatoren für Belastungsreaktionen genutzt. So kann eine Analyse von Bestandteilen im Serum wie Proteine, Enzyme, Wachstumsfaktoren, Cytokine (das Immunsystem beeinflussende Proteine) Hinweise auf die Wirksamkeit des Trainings geben. Bereits ...
Serotonin (serotonin), Hormon und Transmitter, der die funktionierende Nervenverbindung vom Gehirn zum Bewegungsapparat sichert. Durch gezielte Stimulierung der Serotoninrezeptoren kann dieser Prozess optimiert werden, womit zunächst theoretisch möglich ist, die natürlichen Grenzen des Körpers zu durchbrechen und die Leistungsfähigkeit noch weiter zu erhöhen (Cotel et al. 2013). Serotonin wird als „Stimmungsmacher“ therapeutisch gegen Depression eingesetzt. ...
Hämoglobin (hemoglobin), roter Blutfarbstoff in den Erythrozyten, an das eiweißartige Häm gebundenes Eisenmolekül, das in der Lage ist, Sauerstoff zu binden (Oxygenierung). Diesen nimmt er in der Lunge auf und transportiert ihn durch die Blutgefäße. Auf dem Rückweg sorgt er für den Abtransport des Kohlendioxids. →Eisen Als normal gelten folgende Hämoglobin-Werte: Frauen: 12 – 16 ...
Bicarbonat (bicarbonate), Hydrogencarbonat, das als Puffersubstanz eine wichtige Rolle bei der Neutralisierung des Laktats spielt (→Alkalose). Durch Zuführung von Bicarbonat („soda loading“) konnte ein positiver Effekt auf die Leistungsfähigkeit nachgewiesen werden. (Rupp et al. 1983, Sutton et al. 1981, Wilkes et al. 1983). So zeigte sich, dass bei einer Dosis von 300-500 mg HCO3-/kg Körpergewicht ...
Muskelkrampf (muscular spasm; in der Arbeits- und Sportmedizin „exercise-associated muscle cramps“ – EAMC), Funktionsstörung des Muskels als unwillkürliche, schmerzhafte Kontraktion. Im Sport zumeist in folge von Überlastung verbunden mit Unregelmäßigkeiten des Substratstoffwechsels („Stoffwechseltheorie“), der Flüssigkeitsbalance („Dehydratationstheorie“), des Serumelektrolytspiegels („Elektrolyttheorie“) oder durch extreme heiße oder kalte Umweltbedingungen („Umwelttheorie“) (Schwellnus et al. 1997). Die Ursachen werden kontrovers ...
Puffer/Puffersysteme (puffer systems), Chemische Stoffe (Bicarbonat, Hämoglobin, Plasma-Eiweiße, Phosphate), die die Wasserstoffionenkonzentration der Körperflüssigkeiten (pH-Wert) konstant halten und damit auch eine Schlüsselrolle bei der Laktateliminierung einnehmen. →Pufferkapazität Sportliche Aktivitäten mit einer überwiegend anaeroben Energiegewinnung wie Kurzzeit– und Intervallbelastungen bringen die verschiedenen Puffersysteme an ihre Grenzen. Dadurch kann der Blut-pH bis ca. 6.8 absinken, der intrazelluläre pH ...
Kreatinphosphat (creatin phosphate) energiereiches Phosphat, das durch das Enzym Kreatinkinase die Resynthese von ATP aus ADP gewährleistet: ADP + Kreatinphosphat → ATP + Kreatin. Der ATP-/Kreatinphosphatspeicher steht sofort für eine kurzzeitige maximale muskuläre Maximalbelastung bis 20 Sekunden zur Verfügung. →Kreatin Durch die schnelle Verwertbarkeit ist Kreatinphosphat eine wesentliche energetische Grundlage des Schnelligkeitstrainings im Schwimmen (→Belastungszone ...
Sauerstoffdefizit (Oxygen deficit), Differenz zwischen dem Sauerstoffbedarf der Muskulatur und dem arteriellen Sauerstoffangebot, die zumeist durch den langsameren Anstieg der Sauerstoffaufnahme zu Arbeitsbeginn auftritt und nach Arbeitsende nachgeatmet wird (→Sauerstoffschuld) . Energetisch gesehen reicht die aerobe Verbrennung nicht aus, um den Bedarf an Adenosintriphosphat (ATP) bereitzustellen und es wird auf „anaerob umgeschaltet“. Verschiedentlich wird noch ...
Sauerstoff-Mangeltheorie (Oxygen deficiency theory), Theorie, wonach unzureichende Sauerstoffversorgung (→Sauerstoffschuld) auf muskulärer Ebene die Laktatproduktion verursacht. Nach neueren Erkenntnissen sind alternative Mechanismen zu nennen, wie zum Beispiel der Einfluss von Enzymen oder Hormonen (Gladden, 2000). Letztendlich ist die Kapazität der Mitochondrien für die Laktatproduktion entscheidend (Spriet et al., 2000). Ein O2-Mangel muss nicht zwangsläufig, kann aber ...
Sauerstoff (Oxygenium) (Oxygen), griech. oxýs – scharf, sauer und gennaein – erzeugen, hervorbringen; zweiwertiges farb- und geruchloses Gas (O2), das frei in der Natur (Luft, Wasser, Lebewesen) vorkommt und lebenswichtig für den Stoffwechsel ist. Während Nahrungsstoffe gespeichert werden können, ist das bei Sauerstoff nur kurzzeitig möglich. Nach 2-4 Minuten Atemstillstand können bereits erste Störungen auftreten. ...